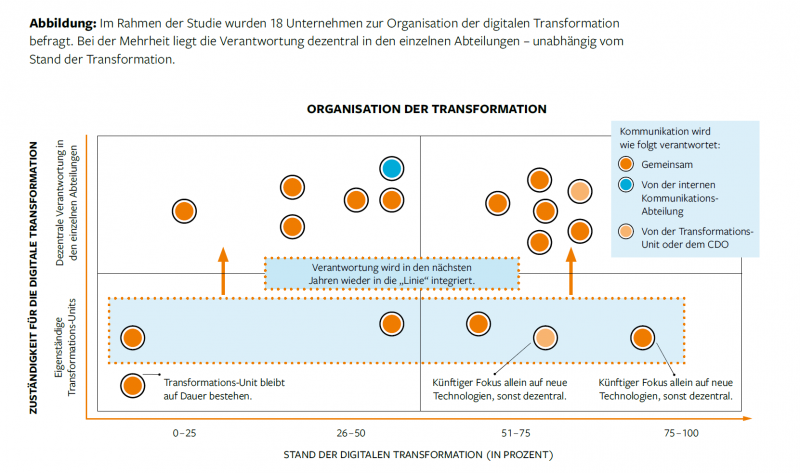Die Zukunft der Arbeit in der neuen Normalität – mehr als nur Homeoffice
Schon seit 2018 gibt es bei Siemens eine Initiative zur Zukunft der Arbeit. Aufgrund der Corona-Pandemie ist diese Zukunft nun schneller Wirklichkeit geworden als gedacht. Mobiles Arbeiten, hybride Arbeitsmodelle, das Büro als Ort der Vernetzung: Die neue Normalität ist Alltag geworden. Ein Zurück gibt es nicht. Im Gegenteil. Nun wird in dem Technologiekonzern auch eine neue Führungskultur vorangetrieben, die auf Befähigung und ein Growth Mindset setzt.
Seit über einem Jahr ist mobiles Arbeiten für Tausende Mitarbeitende von Siemens Alltag – in Deutschland und weltweit. Auch ich arbeite seit Beginn der Pandemie im März 2020 nicht mehr in meinem Büro, sondern von zu Hause. Eine Situation, wie wir sie jetzt erleben, hatte sicher niemand von uns kommen sehen. Und Anfang vergangenen Jahres hätte auch in unserem Unternehmen
niemand die Prognose gewagt, dass die virtuelle Zusammenarbeit großer Teile der Belegschaft auf Anhieb so reibungslos funktionieren würde. Wahr aber ist: Schon lange vor dem Ausbruch der
Covid-19-Pandemie haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie wir in Zukunft (zusammen-)arbeiten werden. Seit 2018 untersuchen wir im Rahmen unserer #FutureOfWork-Initiative neue, zukunftsweisende Arbeitsmodelle und analysieren, wie Digitalisierung und Automatisierung unsere Tätigkeiten und Kompetenzen verändern werden. Die Pandemie hat unsere Initiative und die damit verbundenen Aktivitäten weiter vorangetrieben und gleichzeitig neue Fragen in den Mittelpunkt gerückt:
- Welche Rolle spielt künftig noch das (physische) Büro?
- Inwiefern braucht es eine Anwesenheitspflicht?
- Und wie sieht gute Führung in der digitalen Welt aus?
Gleichgültig, welche Konzepte es zuvor bereits gab – Corona hat die Digitalisierungsambitionen der Wirtschaft radikal beschleunigt. Siemens ist dafür ein gutes Beispiel: Im Juli vergangenen Jahres haben wir als erstes Industrieunternehmen das mobile Arbeiten an zwei bis drei Tagen pro Woche zum Standard in der „neuen Normalität“ ausgerufen. Dieses Angebot an unsere Beschäftigten gilt nach überstandener Pandemie, wenn der Krisenmodus vorbei ist. Das erweiterte mobile Arbeiten im hybriden Modell ist eines der Kernelemente der neuen Normalität, des New Normal Working Models, wie wir es bei Siemens nennen.
Mobiles Arbeiten als Kernelement der neuen Normalität
Ziel unseres „New Normal Working Models“ ist, die bestehenden Regelungen des mobilen Arbeitens für die Zeit nach der Pandemie weiterzuentwickeln. Mit mobilem Arbeiten meinen wir mehr als nur das reine Homeoffice. Stattdessen sollen Mitarbeitende denjenigen Arbeitsort wählen, an dem sie am produktivsten arbeiten können. Dieses neue hybride Arbeitsmodell schließt daher explizit innovative Arbeitsumgebungen wie etwa Co-Working-Spaces oder auch andere Siemens-Standorte mit ein. Wo die Arbeit verrichtet wird, ist im Grunde nicht mehr wirklich relevant.
Was zählt, sind die Ergebnisse. Unser „New Normal Working Model“ sieht vor, dass die Mitarbeitenden die Möglichkeit haben, nach der Pandemie an durchschnittlich zwei bis drei Tagen pro Woche mobil zu arbeiten. Natürlich unter der Prämisse, dass sie sich dies wünschen und es aufgrund ihrer Aufgaben und Anforderungen umsetzbar ist. Dabei ist selbstverständlich, dass mobiles Arbeiten ein freiwilliges Angebot darstellt und keinen Zwang. Wir setzen dies nicht nur lokal, sondern auch auf globaler Ebene um. Insgesamt umfasst das Konzept mehr als 140.000 Mitarbeitende von Siemens an über 125 Standorten in 43 Ländern. Dabei berücksichtigen wir immer lokale gesetzliche Anforderungen und die Vorgaben der jeweiligen Tätigkeiten.
Transformation der Unternehmens und Führungskultur
Das mobile Arbeiten ist sicherlich das greifbarste Element unseres „New Normal Working Models“, für sich allein greift es aber noch zu kurz. Damit es zum Erfolg wird, müssen wir eine umfassende Transformation unserer Unternehmens- und Führungskultur vorantreiben. Was Unternehmen und Führungskräfte brauchen, ist ein gemeinsames Verständnis darüber, wie Mitarbeitende befähigt werden können, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Die Führungskraft nimmt dabei eine signifikante Rolle ein, indem sie den Teammitgliedern die Freiheit gibt, ihre Arbeit so zu gestalten, dass bestmögliche Ergebnisse für Unternehmen, Kunden und Gesellschaft erzielt werden können. Das sogenanntes Growth Mindset steht bei Siemens dabei im Zentrum. Denn nur wer offen gegenüber Veränderungen sowie neuen Arbeitsweisen ist, bleibt auch zukünftig relevant für den Arbeitsmarkt.
Wir sind überzeugt: Führung basiert auf Vertrauen, nicht auf Kontrolle. Es geht darum, Mitarbeitenden das größtmögliche Vertrauen entgegenzubringen, sodass sie ihre Aufgaben erfolgreich erledigen und eigenverantwortlich Entscheidungen treffen können. „Growth Mindset“ und „Empowerment“ – also lebenslanges Lernen vorantreiben und Mitarbeitende befähigen – das sind die beiden zentralen Eckpfeiler, auf denen unser Führungsstil basiert. Ich glaube fest daran, dass wir als Individuen immer dann bessere Entscheidungen treffen, wenn wir im Rahmen unserer Tätigkeit eigenverantwortlich handeln können. Verantwortliches Arbeiten stärkt die persönliche Resilienz sowie die Relevanz für den internen und externen Arbeitsmarkt und dadurch die nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit jedes und jeder Einzelnen. Deshalb ist die Befähigung („Empowerment“) unserer Belegschaft nicht nur ein elementarer Teil des „New Normal Working Models“, sondern auch unserer #FutureOfWork-Initiative. Und schließlich setzen Befähigung und Vertrauen Geschwindigkeit und Agilität frei – wichtige Faktoren, um Leistungspotenziale zu heben und Innovation zu stärken. Aber nicht nur das: Wir haben in der Pandemie gelernt, wie flexibel und anpassungsfähig wir sein können und in Krisen auch sein müssen. Dies nutzen wir, um die digitale Transformation proaktiv zu gestalten.
Kulturelle Weiterentwicklung als Prozess
Jeder, der sich in seinem Leben mit Kulturveränderungen beschäftigt hat, weiß, dass nachhaltiger Wandel Zeit und Geduld erfordert. Wer glaubt, ein Unternehmen mit fast 300.000 Mitarbeitenden quasi über Nacht verändern zu können, wird scheitern. Umso wichtiger ist es, allen Beschäftigten deutlich zu machen, dass die Kulturveränderung eine zentrale Priorität für das Unternehmen hat. Mit einer umfassenden Gesamtbetriebsvereinbarung, die wir erst kürzlich Anfang März mit den Arbeitnehmervertretern geschlossen haben, wurde das „New Normal Working Model“ nun auch formal besiegelt. Die Vereinbarung regelt detailliert alle Rechte, aber ebenso die Pflichten des Einzelnen im „New Normal“. Denn mobiles Arbeiten erfordert ebenfalls ein hohes Maß an Selbstdisziplin, Eigenmotivation, Organisationsfähigkeit, Selbstständigkeit und gegenseitiger Rücksichtnahme.
Vor allem für Führungskräfte hat sich der Kontext durch die Digitalisierung und nun verstärkt auch durch die Pandemie entscheidend verändert; ein neues Führungsverhalten ist gefordert. Das grundsätzliche Verständnis einer digitalen Ökonomie und das handwerkliche Beherrschen diverser Kollaborationstools sind notwendige Fähigkeiten. Führungstugenden und Werte wie Vertrauen, Empathie, Wertschätzung und Offenheit erhalten zudem eine neue Relevanz. Für eine nachhaltige Kulturveränderung haben wir bei Siemens vier Voraussetzungen definiert, die sich auch in unseren Führungskräfteprogrammen wiederfinden. Diese beinhalten erstens das Fördern von Verständnis und Überzeugung – was sich durch das vergangene Jahr fast von allein ergeben hat. Zweitens steht die Entwicklung von Talent und Fähigkeiten im Vordergrund. Drittens ist es wichtig, eine unterstützende Umgebung zu bieten und viertens müssen Führungskräfte, beginnend beim Vorstand, als Vorbilder fungieren. Denn nur wenn man sieht, dass die Elemente des „New Normal Working Models“ und der neuen Kultur gelebter Alltag im Management des Unternehmens sind, ist man bereit, diese auch für sich selbst anzunehmen. Bei uns ist genau das der Fall: Der gesamte Vorstand steht hinter der Idee und ihrer Umsetzung. Dies wird einmal mehr dadurch bestätigt, dass sich das „New Normal Working Model“ nahtlos in unser Konzept von der Zukunft der Arbeit (#FutureOfWork) einfügt.
Das Büro als Ort der Kreativität und des Austauschs
Mobiles Arbeiten ist fester Bestandteil im Arbeitsalltag unserer Mitarbeitenden. Offen bleibt: Welchen Wert haben Büro und Arbeitsplatz überhaupt noch? Verlieren sie an Bedeutung? Wie sollten sie in Zukunft gestaltet sein?
Wir sind davon überzeugt, dass sich die Funktion des Büros tiefgreifend wandeln wird. Künftig wird der Arbeitsplatz ein Ort sein, an dem man „aktivitätsbasiert“ arbeitet. Diese Art der Arbeit muss sich in der architektonischen Struktur des Büros wiederfinden. In Zukunft werden die Menschen auch weniger ins Büro gehen, um dort individuell und ungestört zu arbeiten, sondern vielmehr, um mit anderen Kolleginnen und Kollegen in Kontakt zu kommen, sich auszutauschen, kreative und gemeinschaftliche Prozesse anzuschieben. In den Vordergrund rücken werden also teamorientierte Aktivitäten, die das Büro weit stärker noch als bisher zu einem Ort der persönlichen Begegnung, des Zusammenarbeitens und des Netzwerkens machen. In Zukunft brauchen wir offene und flexible Flächen, also Bereiche für kreative Kollaborations- und Projektarbeit, Räume für konzentriertes Arbeiten und auch Erholungszonen.
Hybride Arbeitsmodelle geben Raum zur Entfaltung
Mit unserem bestehenden Bürokonzept haben wir hierfür bereits an vielen unserer Standorte eine solide Grundlage. Denn bereits in den vergangenen Jahren hat Siemens weltweit für über 80.000 Mitarbeitende neue Arbeitswelten und innovative Formen der Zusammenarbeit eingeführt. Diese werden weniger durch feste Vorgaben als vielmehr durch einen Leitfaden, der sich auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der jeweiligen Standorte und Geschäftseinheiten zuschneiden lässt, umgesetzt. Hieran knüpfen wir an und werden – wann immer erforderlich – unsere Bürowelt an die veränderten Bedürfnisse im „New Normal“ anpassen. Erste Pilotprojekte zur Gestaltung des Büros der Zukunft laufen bereits. Die Covid-19-Pandemie wird enden, doch die Neuerungen in unserer Arbeitswelt werden bleiben und uns weiterhin begleiten. Wir haben sehr frühzeitig tiefgreifende Entscheidungen getroffen, wie wir die neue Normalität im Alltag der Mitarbeitenden umsetzen wollen. Die Vorteile liegen auf der Hand – für die Beschäftigten und für Siemens. Wie eine aktuelle Studie von Boston Consulting Group, Stepstone und The Network zeigt, wünschen sich 81 Prozent der deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, auch in Zukunft hybrid zu arbeiten. Unsere betriebsinternen und internationalen Umfragen bestätigen dies. Mit dem „New Normal Working Model“ kommen wir genau diesem Wunsch nach. Zugleich schärfen wir mit dem Bekenntnis zum mobilen Arbeiten unser Profil in einem sich zuspitzenden Kampf um die besten Talente am Markt. Und nicht nur das: Mit dem „New Normal Working Model“ setzen wir einen weiteren Meilenstein für die Zukunft der Arbeit und ihre proaktive Ausgestaltung. Denn als Unternehmen müssen wir Orientierung geben und Rahmenbedingungen schaffen, damit sich unsere Mitarbeitenden am Arbeitsort ihrer Wahl voll entfalten können.
Autor:
Dr. Jochen Wallisch ist seit November 2016 Executive Vice President HR, Industrial Relations & Employment Conditions bei der Siemens AG in München. Außerdem ist er seit Februar diesen Jahres für die globale Ausbildung der Siemens AG (Siemens Professional Education) verantwortlich. Bevor Jochen Wallisch zu Siemens wechselte, war er unter anderem Geschäftsführer der Lufthansa-Tochter Eurowings.